Jasmin und Alex haben sich ihren Traum vom eigenen Gemüsebetrieb erfüllt. Seit vier Jahren kultivieren sie auf wenigen hundert Quadratmetern frisches Gemüse nach dem Market-Gardening-Prinzip. Ihr Ziel ist es, die regionale Versorgung mit frischen, saisonalen Produkten zu fördern. Doch die Realität sieht oft anders aus: Bürokratische Hürden und ein System, das kleine Betriebe immer wieder ausbremst. Im Interview sprechen sie offen über ihre Anfänge, ihre Erfahrungen mit dem Market-Gardening-Konzept und darüber, was sich im System ändern muss, damit die Landwirtschaft auch in Zukunft nachhaltig und zukunftsfähig bleibt.

Die Idee zu ihrem eigenen Gemüsebetrieb kam Jasmin und Alex beim Einkaufen. Als ihnen auffiel, wie wenig regionales Obst und Gemüse in den Supermarktregalen zu finden ist, wuchs der Wunsch, etwas daran zu verändern. Parallel dazu stellte Alex bereits während seines Agrarwirtschaftsstudiums fest, dass viele Strukturen in der konventionellen Landwirtschaft für ihn nicht mehr stimmig waren. Zeitgleich bezogen Jasmin und Alex eine Gemüsekiste von einer regionalen Marktgärtnerin – und waren von diesem Prinzip begeistert: „Uns hat gefallen, dass wir den Menschen hinter dem Gemüse kannten, wussten, wo es angebaut wird, und dass es ohne lange Transportwege direkt zu uns kommt“, erzählt Jasmin.
Aus dieser Idee wächst ein konkreter Plan. Da sie keinen eigenen Hof übernehmen konnten und geeignete Flächen knapp waren, entdeckten sie das Market-Gardening-Konzept für sich – eine ressourcenschonende Form des Gemüseanbaus auf kleiner Fläche. „Man braucht keine riesigen Flächen, um anzufangen – ein paar hundert Quadratmeter reichen, um ein funktionierendes System aufzubauen.“ Für die beiden war schnell klar: Genau das passt zu ihrer Vision von zukunftsfähiger, regionaler Landwirtschaft.

Effizient und nachhaltig: Gemüseanbau nach dem Market-Gardening-Prinzip
Jasmin und Alex setzen beim Anbau auf das Market-Gardening-Prinzip – eine Form des biointensiven Gemüsebaus, die darauf abzielt, auf kleiner Fläche möglichst viel und vielfältig zu ernten. „Wir arbeiten mit festen Dauerbeeten, die nicht von schweren Maschinen befahren werden. So bleibt der Boden locker und fruchtbar“, erklärt Alex. Ein großer Vorteil: Statt wie im klassischen Ackerbau nur eine Kultur pro Jahr anzubauen, wachsen bei ihnen mehrere Kulturen parallel auf derselben Fläche. Das macht ihre Anbauweise nicht nur effizienter, sondern auch ökologischer.
Nachhaltigkeit bedeutet für sie auch, komplett auf Mineraldünger und chemische Pflanzenschutzmittel zu verzichten. So kommen bei der Düngung ausschließlich Kompost und organische Düngemittel zum Einsatz. „Besonders bei Kohlgewächsen kämpfen wir regelmäßig mit Schädlingen“, berichten sie. Zum Schutz der Pflanzen greifen sie neben Nützlingen auch auf feinmaschige Netze zurück, die sie über das Gemüse spannen. Gegen Schnecken haben sie vor kurzem begonnen, Laufenten zu halten.

Boden – Das wertvollste Kapital für gesunde Ernten
„Der Boden ist für uns die Grundlage von allem – unser größtes Kapital. Ohne einen intakten Boden wäre es kaum möglich, gesunde Pflanzen und hochwertiges Gemüse anzubauen“, betont Alex. Um die Qualität ihres Bodens langfristig zu sichern, führen sie regelmäßig Bodenanalysen durch, die eine genaue Nährstoffverteilung zeigen. So können sie gezielt auf fehlende Elemente reagieren.
Neben den regelmäßigen Tests legen Jasmin und Alex großen Wert auf eine nachhaltige Pflege ihres Bodens. „ Wir gönnen unserem Boden regelmäßig Kompost aus heimischen Kompostwerken und sorgen so dafür, dass organisches Material immer im Überfluss vorhanden ist.” Zusätzlich sammeln und kompostieren sie eigene Abfälle wie unschöne Salatblätter oder Grünzeug, das nicht an die Kunden geht, und bringen diese wieder auf die Beete, um die Bodenfruchtbarkeit zu fördern.

Ständiges Lernen und Weiterentwickeln
„Man lernt nie aus – jedes Jahr ist anders“, sagt Jasmin. Besonders in den ersten Jahren haben sie versucht, mit der Aussaat bereits im Februar zu starten, doch mussten schnell feststellen, dass sich die Bedingungen jedes Jahr ändern. „Letztes Jahr haben wir gemerkt, dass die ersten Pflanzen vom zweiten Satz überholt wurden, weil es noch zu kalt war“. Daher passen sie ihre Pflanzzeit im Freiland inzwischen flexibel an das regionale Klima an.
Jasmin betont zudem die Unterstützung aus der Community: „Wir haben ein Marktgärtnerei-Netzwerk in NRW mit einer WhatsApp-Gruppe, in der man jederzeit Fragen stellen kann. Da bekommt man oft schnelle Hilfe und wertvolle Lösungen.“ Die Gruppe, die aus gelernte Gärtnern und auch Fachfremden besteht, hilft dabei, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam zu wachsen.

Direktvermarktung aus Überzeugung
Ihre Produkte verkaufen sie über verschiedene Kanäle. Neben einem Hofverkauf und der Marktschwärmer Plattform bieten sie in diesem Jahr erstmals eine Gemüse-Abo-Kiste an, die von Mai bis November verfügbar ist. Jede Kiste enthält sechs bis acht verschiedene Kulturen, die je nach Saison und Ernte zusammengestellt werden. Über Instagram informiert Jasmin ihre Kunden wöchentlich darüber, was aktuell in der Kiste enthalten ist und liefert passende Rezepte dazu.
“In unserer Region gilt oft: Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.“ Daher ist es ihnen wichtig, regelmäßig vor Ort zu sein und den direkten Kontakt zu den Kunden zu pflegen, um Feedback zu erhalten und Aufklärung zu bieten. „In den Gesprächen mit unseren Kunden merken wir schnell, was gut ankommt und bei welchen Produkten noch Unsicherheiten bestehen“, erklärt Alex. Aus dieser direkten Rückmeldung leiten sie ab, welche Produkte sie anbauen.

Der Einfluss des regionalen Anbaus auf Gemeinschaft und Umwelt
Der regionale und saisonale Anbau von Gemüse hat für Alex und Jasmin nicht nur positive Auswirkungen auf die Umwelt, sondern stärkt auch die lokale Gemeinschaft und Wirtschaft. Besonders der enge Kontakt zu ihren Kunden ist für die beiden von großer Bedeutung: „Es ist schön zu sehen, dass wir einen treuen Kundenstamm haben, der uns jedes Jahr begleitet“, sagen sie. In den Wintermonaten trifft man sich oft zufällig in der Stadt oder im Dorf, und die Vorfreude auf die kommende Saison ist spürbar. „Das ist die beste Belohnung für die anstrengenden Monate im Frühjahr.“
Ein großer Vorteil des regionalen Anbaus sind für sie die kurzen Lieferwege. „Wir verkaufen direkt an der Fläche, wodurch der Transportaufwand minimiert wird. Viele unserer Kunden kommen sogar mit dem Fahrrad“, erklärt Jasmin. Zudem achten sie darauf, ressourcenschonend zu arbeiten – sie gießen nur, wenn es wirklich nötig ist, und verwenden überwiegend Regenwasser.
„Weniger Gemüseimport und mehr regionaler Anbau würden viel bewirken, aber dafür müsste das System grundlegend verändert werden“, so ihre Überzeugung. Eine große Herausforderung sei unter anderem der Preisdruck in den Supermärkten: „Wir können ein Bund Radieschen nicht wie im Discounter für 50 Cent verkaufen.“ Dennoch sind sie davon überzeugt, dass die Menschen bei geringeren Lebenshaltungskosten und einem breiteren regionalen Angebot eher bereit wären, mehr für lokale Produkte zu zahlen. „Theoretisch könnten wir uns hier selbst versorgen – die Ressourcen sind da.”

Politische Hürden und Herausforderungen für kleine landwirtschaftliche Betriebe
Alex und Jasmin sehen die Politik als einen entscheidenden Faktor für Veränderungen in der Landwirtschaft. Sie berichten, dass sie oft „zu klein“ sind, um auf dem politischen Radar zu erscheinen. Besonders die Vergrößerung ihrer Fläche stellte sie vor große Herausforderungen. Der Weg zur Finanzierung war lang und bürokratisch. „Es hat mehr als ein Jahr gedauert, bis wir das auf die Beine gestellt haben“, berichten sie. Hürden wie fehlende Betriebsnummern bei der Landwirtschaftskammer und komplizierte Antragsverfahren erschwerten den Zugang zu Förderungen und Krediten. Besonders problematisch sei, dass viele Förderungen für Direktvermarkter nicht für ihren Betrieb gelten, da sie weder ein klassischer Bio-Betrieb noch ein typischer Direktvermarkter sind. „Wenn man aus dem Schema rausfällt, hat man es einfach furchtbar schwierig“, so Alex.
Ein weiteres Problem ist der schwierige Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen. „Ohne das Glück, eine alte Gärtnerei zu kaufen oder etwas zu erben, ist es nahezu unmöglich, in der Landwirtschaft Fuß zu fassen. Schon die erste Hürde ist für viele unüberwindbar“.
Hinzu kommt der enorme Bürokratieaufwand, der besonders kleinere Betriebe belastet. „In unserem Fall ist es noch überschaubar, weil wir keine großen Flächen oder Tierhaltung betreiben. Doch gerade bei der Tierhaltung mit den vielen Auflagen und der mangelnden Planbarkeit fällt es vielen kleinen Betrieben schwer, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Sie verbringen mehr Zeit mit Bürokratie als mit der eigentlichen Arbeit“, so die beiden.
Darüber hinaus stellen die langen und anstrengenden Arbeitszeiten in der Landwirtschaft, besonders während der Saison, eine Herausforderung dar, die vor allem junge Menschen abschreckt. „Es geht nicht nur um den finanziellen Aspekt, sondern auch um die immer schwieriger zu erreichende Work-Life-Balance. Besonders im Gemüsebau sind die Monate von April bis Mai sehr intensiv“, erklärt Alex. Auch wenn mittlerweile mehr Rücksicht auf die Mitarbeiter genommen wird, bleibt der Beruf dennoch herausfordernd. „Viele Betriebe können sich keine Mitarbeiter leisten, weil die Verkaufspreise für die Produkte so gering sind, dass kaum genug für die Löhne übrig bleibt“. Sie warnen, dass steigende Auflagen und unzureichende Bezahlung den Sektor zusätzlich belasten.

Visionen für eine nachhaltige Zukunft
Derzeit arbeitet Jasmin noch als Physiotherapeutin, um eine sichere Einnahmequelle zu haben, die sie momentan noch für den Betrieb benötigen. Die zusätzlichen Einnahmen aus der Landwirtschaft reinvestieren die beiden meist direkt in den Betrieb – etwa in neue Geräte oder Folientunnel. Ihre langfristige Vision ist es, den Betrieb so auszubauen, dass er irgendwann ihren vollständigen Lebensunterhalt sichert. „Das ist unser vorrangiges Ziel, und daran arbeiten wir kontinuierlich“, erklären sie.
Zudem planen sie, ihre Vertriebskanäle weiter auszubauen. „Wir möchten verstärkt mit Hofläden in der Region zusammenarbeiten und überlegen, vielleicht sogar einen Selbstbedienungsladen einzurichten.“ Ziel ist es auch, mehr Menschen für nachhaltige, regenerative Landwirtschaft und Market Gardening zu begeistern. „Viele Menschen sind mit diesen Konzepten noch nicht vertraut. Wir möchten mehr Bewusstsein dafür schaffen. Der Austausch mit anderen Marktgärtnern ist dabei besonders wertvoll, denn „es gibt kaum Konkurrenzdenken – wir helfen uns gegenseitig, teilen Erfahrungen und lernen voneinander.“ Die wachsende Zahl junger Menschen, die diesen Weg wählen, sehen sie als positives Zeichen: „Es ist großartig zu sehen, dass immer mehr Menschen sich für nachhaltige und regionale Landwirtschaft begeistern.“
Autorin: Lotte Dall




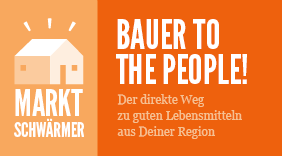










Kommentare