Eine neue landwirtschaftliche Roadmap für Europa zeichnet sich ab – und der erste Entwurf sorgt bereits für Aufsehen. Anfang Juli 2025 hat die Europäische Kommission ihren ersten Vorschlag für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) für den Zeitraum 2028–2034 veröffentlicht. Der Vorschlag, der erhebliche strukturelle Änderungen und Budgetkürzungen vorsieht, stößt im Agrarsektor auf breite Ablehnung. Bauernverbände rufen zu Protesten in Brüssel auf.
Aber was steht eigentlich auf dem Spiel? In diesem Artikel beleuchten wir die wichtigsten Änderungen und analysieren, was sie für die Zukunft der regenerativ-biologischen Landwirtschaft in Europa bedeuten könnten.
Ist das schon ernst?
Was bisher vorliegt, ist der erste Vorschlag der Europäischen Kommission. Nun beginnt ein langer und komplexer Gesetzgebungsprozess, der ein bis zwei Jahre dauern kann. Die drei beteiligten Institutionen (Kommission, Rat und Parlament) werden verhandeln, und das Endergebnis unterscheidet sich oft deutlich vom ersten Entwurf.
Gerade weil es sich nur um einen Vorschlag handelt, ist jetzt der entscheidende Moment, um sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene Druck auszuüben und die Verhandlungen zu beeinflussen. Die endgültigen Regeln für 2028 sind noch nicht in Stein gemeißelt.

Das Herzstück der Veränderung: Weniger Budget und zwei neue Kampfplätze
Um den Vorschlag zu verstehen, müssen wir drei miteinander verbundene Änderungen betrachten: ein kleineres Budget, eine neue interne Struktur und ein neues Verhältnis zu anderen nationalen Fonds. Zusammen schaffen sie zwei neue Kampfplätze um Fördermittel.
1. Ausgangspunkt: Ein kleinerer Kuchen
Die erste und offensichtlichste Änderung ist die Budgetkürzung. Das gesamte GAP-Budget wird von 387 Milliarden € (aktuelle Periode) auf 300 Milliarden € für 2028–2034 reduziert. Inflationsbereinigt bedeutet das eine reale Kürzung um fast 30 %. Dies ist nicht nur eine Sparmaßnahme, sondern Teil einer breiteren Neuausrichtung der EU-Prioritäten auf Bereiche wie Verteidigung und Raumfahrt. Kurz gesagt: Es gibt weniger Geld zu verteilen.
2. Kampfplatz Nr. 1: Der interne Verteilungskampf
Die zweite große Änderung ist die Abschaffung der „zwei Säulen“, die die GAP seit Jahrzehnten geprägt haben:
- Säule 1: Direkte Einkommensstützung für Landwirte.
- Säule 2: Entwicklung des ländlichen Raums, einschließlich wichtiger Förderungen für Umweltmaßnahmen, ökologischen Landbau und Investitionen in die Modernisierung. Viele unserer regenerativen Landwirte konnten über diese Säule finanzielle Unterstützung erhalten.
Der neue Vorschlag führt alles in einem einzigen Topf zusammen. Die Kommission sagt, dieser Agrartopf werde „zweckgebunden“ („ring-fenced“), sodass nationale Regierungen diesen Mindestbetrag nicht für nicht-landwirtschaftliche Zwecke verwenden können.
Das schafft jedoch einen harten Konkurrenzkampf innerhalb des Zauns: Ohne die Trennung der beiden Säulen konkurrieren Umweltmaßnahmen nun direkt mit der Basis-Einkommensstützung um jeden Euro.
Was bedeutet dieser interne Kampf für die Nachhaltigkeit in der Praxis?
Die Auswirkungen sind konkret:
- Die verpflichtenden Umweltauflagen für alle (die sogenannten GAEC – „Gute landwirtschaftliche und ökologische Bedingungen“) sollen wegfallen. Das waren die Mindestregeln, die Landwirte einhalten mussten, um Beihilfen zu erhalten – z. B. einen Mindestanteil an Flächen für die Biodiversität freizuhalten, Fruchtfolgen einzuhalten oder Bodenbedeckung zu gewährleisten. Künftig wird jedes Land seine eigenen „Mindestpraktiken für Nachhaltigkeit“ festlegen.
- Die freiwilligen Anreize für Landwirte, die über das Mindestmaß hinausgehen, hängen vollständig vom nationalen Willen ab. Die derzeitigen Öko-Regelungen (Eco-Schemes) sollen in die bestehenden Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) integriert werden.
Traditionell wurden über diese AUKM und Öko-Regelungen Praktiken gefördert wie:
- Anbau von Zwischenfrüchten.
- Anlage von Blühstreifen für Bestäuber.
- Extensive Viehhaltung.
- Umstellung auf und Beibehaltung von ökologischer Bewirtschaftung.
Mit der neuen Struktur entscheidet die nationale Regierung, wie viel ihres zweckgebundenen Agrarbudgets sie für diese wichtigen AUKM bereitstellt – vielleicht 30 %, vielleicht nur 5 %. Das Risiko: Unter dem Druck eines kleineren Gesamtbudgets könnten Regierungen den Großteil der Mittel für Basiszahlungen verwenden und nur minimale Beträge für den Übergang zu regenerativer und ökologischer Landwirtschaft bereitstellen.
3. Kampfplatz Nr. 2: Der externe Verteilungskampf
Die dritte Änderung: Der neue, einheitliche Agrarfonds wird nicht mehr unabhängig sein. Er wird in einen großen nationalen „Megafonds“ integriert, zusammen mit anderen Prioritäten wie den Kohäsionsfonds für die Regionalentwicklung.
Die Zweckbindung garantiert nur ein Mindestbudget für die Landwirtschaft. Will der Agrarsektor mehr Mittel für ehrgeizige Projekte (z. B. eine landesweite Umstellung auf Bio-Landwirtschaft), muss er jedes Jahr gegen andere starke nationale Interessen kämpfen – und nicht mehr nur alle 7 Jahre auf EU-Ebene. Das Landwirtschaftsministerium muss also für jeden zusätzlichen Euro direkt mit anderen Ministerien konkurrieren.

Was das für Landwirte bedeutet: Risiken und (einige) Chancen
Mögliche Vorteile:
- Mehr Unterstützung für Junglandwirte: Der vorgeschriebene Mindestanteil der Mittel für Junglandwirte soll von 3 % auf 6 % verdoppelt werden.
- Theoretisch gerechtere Zahlungen: Obergrenzen („Capping“) und Degressivität sollen verschärft werden, um sehr große Betriebe zu begrenzen und mittlere sowie Familienbetriebe zu stärken.
- Bessere Definition des „aktiven Landwirts“: Beihilfen sollen nur an diejenigen gehen, die tatsächlich die Flächen bewirtschaften.
- Neuer „Betriebsentlastungsdienst“: Ein System, das Landwirten leichter Urlaub oder Auszeiten ermöglicht.
Große Risiken:
- Nachhaltigkeit hängt von nationaler Politik ab: Das Budget für Umweltmaßnahmen wie Bio- und regenerative Landwirtschaft ist nicht mehr geschützt. Es hängt allein vom politischen Willen der jeweiligen Regierung ab.
- Verlust gemeinsamer Standards: Mit national unterschiedlichen Mindestauflagen droht ein „Wettlauf nach unten“, bei dem Länder Standards senken, um wettbewerbsfähiger zu sein.
- Ausschluss pensionierter Landwirte: Ab 2032 sollen Personen, die eine Altersrente beziehen, keine GAP-Zahlungen mehr erhalten. Das könnte in ländlichen Regionen zu schnellerer Landaufgabe führen.
Fazit: Nationale Politik wird wichtiger denn je
Die Botschaft der Europäischen Kommission lautet: Mehr Flexibilität und Macht für die nationalen Regierungen. Für unsere Landwirte ist klar: Die Zukunft der Förderung für Bio- und regenerative Landwirtschaft hängt künftig stark von der nationalen Politik ab.
Ab 2028 wird es nicht mehr reichen, nur nach Brüssel zu schauen – Druck auf nationaler Ebene wird entscheidend sein, um eine echte Transformation hin zu nachhaltiger Landwirtschaft zu sichern.

Resilienz jenseits von Subventionen aufbauen
Diese Phase großer Unsicherheit zeigt eine grundlegende Wahrheit: Sich ausschließlich auf politische Subventionen zu verlassen, ist eine fragile Strategie. Lobbyarbeit bleibt wichtig, doch langfristige Sicherheit entsteht durch Resilienz auf Betriebsebene.
Hier wird das Direktvermarktungsmodell zu einem entscheidenden Puffer: Für Bio- und regenerative Landwirte bietet die direkte Verbindung zu Verbrauchern, die ihre Arbeit verstehen und wertschätzen, eine stabilere wirtschaftliche Grundlage. In einer Zeit, in der sich politische Rahmenbedingungen unvorhersehbar ändern können – möglicherweise nun mit kürzeren nationalen Entscheidungszyklen – ist das stärkste Werkzeug eines Landwirts ein widerstandsfähiger Betrieb und eine enge Verbindung zu den Menschen, die seine Produkte essen.




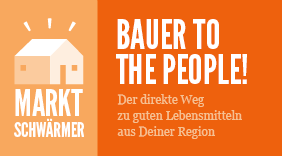









Kommentare