Seit Jahrzehnten hat sich die industrielle Landwirtschaft als dominantes Modell durchgesetzt – mit dem Hauptziel, die Erträge zu steigern. Kurzfristig effektiv, gefährden diese Praktiken jedoch die Resilienz und Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Systeme angesichts klimatischer Risiken und Krankheiten, mit schwerwiegenden Folgen für die Biodiversität. Doch ohne Leben auf den Feldern kann keine Kultur dauerhaft gedeihen. Die Menschheit zu ernähren, darf nicht bedeuten, das Leben auszuhungern. Was wäre, wenn wir die Richtung ändern?
Warum bedrohen bestimmte Praktiken die Biodiversität?
Felder vom Leben entleeren – durch tote Böden

Traktor und die Verzweiflung des Bodens © Wolfgang Eckert / Pixabay
Lange Zeit galt das tiefe Pflügen als gute landwirtschaftliche Praxis, doch es stört das natürliche Gleichgewicht der Böden massiv. Beim tiefen Umgraben gelangen Mikroorganismen, die normalerweise im Dunkeln leben, an die Oberfläche und sterben ab. Diese Massensterben reichern den Boden im ersten Jahr zwar an, doch in Wirklichkeit ist der Boden bereits tot. Eine weitere Folge: Durch das tiefe Pflügen wird im Boden gespeicherter Kohlenstoff freigesetzt – das verschärft den Klimawandel.
Hinzu kommen wiederholte Fahrten schwerer Maschinen, die den Boden verdichten und Insektengänge zerstören. Das Ergebnis: ein erstickter Boden, der Wasser schlecht aufnimmt und auf dem Pflanzen schlecht wachsen.
Eine grüne Wüste: die Monokultur

Endlose Felder © Sachin Kumar / Pixabay
Stellen Sie sich endlose Maisfelder oder riesige Weizenfelder ohne Hecken oder Büsche vor. Das ist kein Albtraum – das ist unsere Realität. Für kurzfristige Rentabilität wurde auf industrielle Monokultur gesetzt. Doch das Verschwinden der Vielfalt an Kulturpflanzen hat drastische Auswirkungen auf Insekten, Vögel und natürlich auf den Boden. Warum? Weil ein Boden, der immer nur dieselben Wurzeln sieht, auslaugt. Er verliert Nährstoffe, Leben und seine natürliche Regenerationskraft – die ihm eine Vielfalt an Pflanzenarten bieten könnte.
Die Folge? Landwirte gleichen die zunehmende Verarmung ihrer Böden mit immer mehr chemischem Dünger aus. Ein Teufelskreis entsteht: Schädlinge und Krankheiten breiten sich rasant aus, da ihre natürlichen Feinde fehlen und die geschwächten Pflanzen leichte Beute sind. Das wiederum führt zu noch mehr Pestiziden und Fungiziden, die den Boden zusätzlich belasten und die Pflanzen weiter schwächen.
Pestizide und Herbizide: das stille Massensterben
Herbizide, eingesetzt, um Felder “sauber” zu halten, töten alles auf ihrem Weg. Glyphosat und seine Verwandten beseitigen alle sogenannten “Unkräuter”: Löwenzahn, Klee, Brennnesseln… Doch genau diese Pflanzen sind essenziell für unsere Bestäuber. So entstehen schnell pflanzen- und tierleere Landschaften.
Als wäre das nicht genug, verschärft der massive Einsatz von Pestiziden das Problem: Viele Bestäuber sterben. Besonders tückisch sind Neonicotinoide. Sie werden als Saatgutbehandlung eingesetzt (v.a. bei Mais, Rüben oder Raps) und durchdringen die gesamte Pflanze – sodass keine Nachbehandlung nötig ist. Klingt praktisch? Ist es aber nicht. Denn diese Stoffe kontaminieren auch Pollen und Nektar. Die Folge: Bienen werden schleichend vergiftet, verlieren ihre Orientierung, werden unfruchtbar oder finden ihren Stock nicht mehr – und sterben. Eine unsichtbare, aber reale Katastrophe, die unsere Fähigkeit bedroht, Obst und Gemüse zu produzieren.

Neonicotinoide – Bienen in Gefahr © Pixabay
Eine andere Landwirtschaft ist möglich (und existiert bereits)
Angesichts des Teufelskreises der heutigen Landwirtschaft entwickeln tausende Landwirte neue Wege – lebensfreundlich und wirtschaftlich tragfähig.
Le Bec Hellouin: Die Modellfarm für Permakultur
Im französischen Département Eure gelegen, steht die Ferme du Bec Hellouin exemplarisch für die Verbindung von Agrarökologie, Permakultur und Energieeffizienz. Seit 2003 werden dort das ganze Jahr über auf kleinen Flächen Gemüse angebaut – mit Unterstützung der Natur (Mulchen, Mischkultur, Lasagnebeete…). Eine INRA-Studie von 2011 zeigte sogar, dass die Farm pro Hektar rentabler ist als viele konventionelle Betriebe. Ab 2015 fasste das Team seine Forschung im Bereich Bio-Gemüsebau zusammen und entwickelte das Konzept der permakulturellen Mikro-Farm, das europaweit und international an Bedeutung gewinnt.

Lösungen gibt es – und sie funktionieren! © Conger Design / Pixabay
In Spanien: Regenerative Landwirtschaft auf dem Vormarsch – La Junquera
Die Finca La Junquera in der Region Murcia im Süden Spaniens ist ein inspirierendes Beispiel für den Übergang zur regenerativen Landwirtschaft. Angesichts degradierter Böden und eines ariden Klimas hat der Betrieb seit 2015 Maßnahmen zur Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit und Klimaanpassung ergriffen. Der Anbau alter Getreidesorten (resistenter gegen extreme Bedingungen) sowie Kompostierung, Mulchen und Fruchtfolge halfen, die Erträge zu stabilisieren und die Bodenerosion zu verringern.
In Österreich: Biodiversität im Zentrum – Grand Farm
Die von Alfred Grand geführte Grand Farm bei Wien umfasst 90 Hektar und verbindet Agroforstwirtschaft, Gemüseanbau und Bodenaufbau (z. B. durch Wurmkompost). Sie dient zugleich als Forschungszentrum und arbeitet mit Universitäten zusammen, um die Landwirtschaft der Zukunft mitzugestalten. 2024 wurde sie als erste europäische Farm mit dem Siegel „Regenerative Organic Certified“ ausgezeichnet.
Und jetzt?
Der Wandel unseres Agrarmodells ist dringend notwendig – nicht nur zum Schutz der Biodiversität, sondern auch für nachhaltige Ernährung, lebendige Böden und resiliente ländliche Räume im Klimawandel. Die Lösungen sind da. Sie sind oft lokal, manchmal experimentell, doch sie eint eine gemeinsame Grundlage: das Leben wieder ins Zentrum der Landwirtschaft zu stellen.




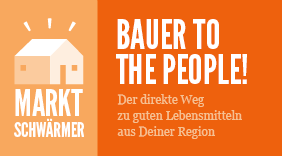










Kommentare