Heute sprießen Labels wie „nachhaltig“, „ökologisch“, „verantwortungsbewusst“ überall in den Regalen. Für Verbraucher ist das oft ein Versprechen: besser für die Umwelt, mehr Transparenz. Aber wie erkennt man, was echt ist und was Greenwashing? Und welche Rolle spielen Labels im heutigen europäischen Lebensmittelsystem?
Sogenannte Öko-Labels entstanden, weil Verbrauchern, bei immer mehr grüner Marketing-Sprache, oft Orientierungspunkte fehlen. Laut FAO ist ein Öko-Label ein Umweltqualitäts-Siegel, das auf Produkte angewendet wird, die gegenüber Konkurrenzprodukten weniger Umweltbelastung verursachen. Sie beruhen auf der Theorie der „asymmetrischen Information“: der Produzent kennt die tatsächlichen Praktiken, der Käufer nicht – das Label hilft, dieses Ungleichgewicht zu verringern. Optimalerweise ist ein glaubwürdiges Label unabhängig, streng, geprüft und transparent. Die Idee klingt super: Einkäufe in zu Produkten mit geringerer Umweltbelastung zu steuern, gute Praktiken fördern und Unternehmen zu nachhaltigeren Lieferketten bewegen.
Wenn Labels sogar den Geschmack beeinflussen
Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass ein Produkt mit Labels wie „ethisch“, „lokal“ oder „niedriger CO₂-Fußabdruck“ besser schmeckt? Neuere Studien zeigen: Essen, das mit deinen Werten übereinstimmt, kann wirklich beeinflussen, wie du den Geschmack wahrnimmst – und wie viel Freude du daran hast.
Eine Studie aus 2013 von der Universität Gävle in Schweden verdeutlicht das. Studierende probierten zwei Kaffees, angeblich unterschiedlich: einer „öko-verantwortlich“, der andere nicht. Die meisten sagten, ihnen schmecke der „nachhaltige“ Kaffee besser – obwohl beide Tassen identisch waren. Noch erstaunlicher: Als einige Teilnehmende später erfuhren, dass sie tatsächlich den nicht-nachhaltigen Kaffee bevorzugt hatten, sagten diejenigen, für die Umwelt wichtig ist, dennoch, sie wären bereit, mehr für die „grüne“ Version zu zahlen.
Das, was Forscher den „grünen Halo-Effekt“ nennen, zeigt, wie sehr Labels unsere Entscheidungen und Wahrnehmungen beeinflussen können – manchmal stärker als das Produkt selbst. Die Marken wissen das, und manche spielen clever damit. Der Markt für grüne Produkte ist lukrativ: McKinsey und Nielsen IQ sagen, dass Produkte mit Umwelt- oder Sozialversprechen schon mehr als 56 % des Umsatzwachstums im Lebensmittelbereich in den USA ausmachen. Produkte mit mehreren Versprechen, wie „Bio“ und „Fair“, wachsen sogar doppelt so schnell wie solche mit nur einem.
Hinter dem positiven Trend bleibt eine Frage: Haben all diese Versprechen auch Substanz? Ohne strenge Regeln und rigorose Kontrollen verschwimmen die Grenzen zwischen engagierter Kommunikation und Greenwashing.
Labels zu zahlreich, zu unterschiedlich

In der EU gibt’s über 200 Labels im Lebensmittelbereich, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben – alle mit unterschiedlichen Kriterien, Methoden und manchmal Widersprüchen. Die EU-Kommission arbeitet gerade daran, dieses Etikettensystem zu harmonisieren, unter anderem durch die Überarbeitung der Green Claims Verordnung und die Vorschläge zur Food Information to Consumers. Auch das Europäische Parlament verfolgt diese Entwicklungen, um Umwelt-Behauptungen zu regulieren.
INRAE-Studien zeigen, dass eine der großen Herausforderungen ist, Labels für Verbraucher verständlich zu machen: Was unterscheidet „nachhaltig“, „klimafreundlich“ oder „biodivers“? Verbrauchertests zeigen, dass Vereinfachung beim Verstehen hilft, aber wichtige Nuancen können verloren gehen. (INRAE, Harmonising environmental labelling in Europe)
In diesem Kontext ist zum Beispiel der Planet-Score entstanden, ein französischer Vorschlag, unterstützt von Forschung und nachhaltiger Landwirtschaft. Er baut auf der öffentlichen Datenbank Agribalyse auf und bewertet Lebensmittel nach drei Hauptkriterien: Klima, Biodiversität und Pestizide. Anders als andere Öko-Bewertungssysteme, die sich auf den CO₂-Fußabdruck beschränken, bezieht Planet-Score oft übersehene Indikatoren mit ein: Wirkung auf Bestäuber, Bodenverschmutzung und Produktionsmethoden.
Sein Ziel ist zweifach: einen umfassenderen Überblick über die Umwelt-Folgen eines Lebensmittels bieten und konkrete Veränderungen zu fördern hin zu gesünderen landwirtschaftlichen Praktiken. Dieses Modell bringt Transparenz und Fortschritt in den Vordergrund statt nur Produktvergleiche, die bestrafen.
Was kommt als Nächstes für Öko-Labels?

Damit Öko-Labels wirklich helfen, das Lebensmittelsystem zu verändern, braucht es Entwicklungen. Das große Thema bleibt die europäische Harmonisierung: gemeinsame, anspruchsvolle und überprüfbare Kriterien aufstellen, die Zuverlässigkeit der Aussagen sichern und die Konkurrenz von Labels eindämmen. Diese Kohärenz muss einhergehen mit stärkerer Kontrolle und abschreckenden Strafen bei Missbrauch.
Zugleich zeigen Tools wie Planet-Score: man kann eine zusammengesetzte, verständliche Bewertung bieten, die auf transparenten Daten fußt. Wenn solche Systeme rigoros bleiben, könnten sie Bürgern eine klare Orientierung für ihre Kaufentscheidungen geben – ohne die Komplexität der Umweltprobleme zu opfern.
Und schließlich: Verbraucherbildung muss gestärkt werden, denn wirklich zu verstehen, was diese Logos bedeuten, heißt auch, mehr Kontrolle darüber zu haben, was auf dem eigenen Teller landet.




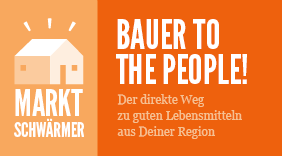






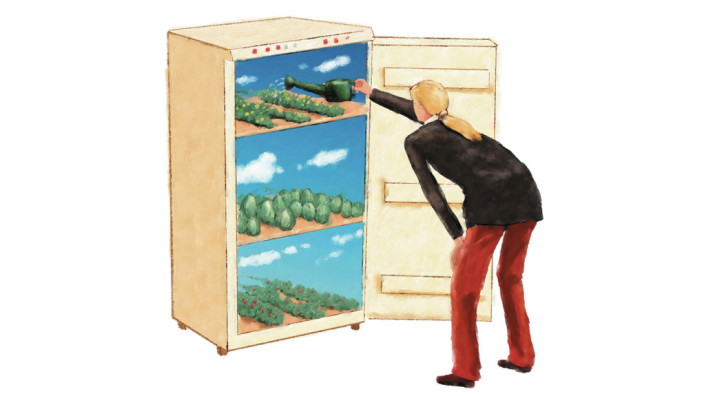

Kommentare