Je länger die Lieferkette, desto bitterer der Beigeschmack! Umweltverschmutzung und Artensterben als Vorspeise, Spekulation und Hunger als Dessert – globale Versorgungssysteme haben ihre Schattenseiten. Doch dieses Modell gerät ins Wanken. Vielleicht ist es an der Zeit, unsere Lebensmittelversorgung wieder regionaler zu gestalten.
Man stelle sich vor, die Hungersnot von 2022 wiederholt sich: Als Russland und die Ukraine den Export von Getreide, Öl und Gas stoppten, schossen die Lebensmittelpreise weltweit in die Höhe. Die Folge: Millionen Menschen in Afghanistan, Äthiopien, Jemen und Südsudan litten unter Mangelernährung und Hungersnot – während die fruchtbaren Böden Osteuropas ungenutzt blieben.
Ein bitterer Widerspruch: Die „Grüne Revolution“ sollte die Welt ernähren, indem sie auf industrielle Landwirtschaft und globalen Handel setzte. Doch in Wahrheit hat dieses System komplett versagt.
Profite über Menschenleben
Im globalisierten System wird Nahrung wie jede andere Ware behandelt und an den Finanzmärkten gehandelt – auch wenn dabei Menschenleben auf dem Spiel stehen. Dies zeigte sich deutlich während der Lebensmittelkrisen von 2020 und 2022. Die NGOs Foodwatch und CCFD Terre Solidaire analysierten den französischen Markt und fanden heraus, dass der Einkauf von Nahrungsmittelvorräten durch rein finanzielle Akteure, wie Investoren und Unternehmen, die keine direkte Verbindung zur Lebensmittelproduktion oder -verteilung haben – um unglaubliche 870 % zunahm.
Zu diesem Zeitpunkt wurden drei Viertel der Lebensmittelgeschäfte nicht durchgeführt, um die Nahrungsmittel an Verbraucher zu verkaufen, sondern um sie an andere Spekulanten weiterzugeben. „Die Volatilität der Agrarrohstoffpreise macht diesen Markt besonders attraktiv für spekulative Aktivitäten“, heißt es in dem Bericht.

Durch die Spekulation stiegen die Preise für diese „finanziellen Produkte“ dramatisch: +48 % für Getreide! Und die Hungersnot verschärfte sich weiter. „Durch übermäßige Spekulation reißen diese Finanzakteure einen Teil des Wertes von Nahrungsmitteln an sich und erzielen in Krisenzeiten besonders hohe Gewinne“, erklärt der Bericht. Laut Foodwatch besteht mittlerweile mehr als die Hälfte des europäischen Lebensmittelmarkts aus finanziellen Akteuren, die ausschließlich auf Profit aus sind – und weltweit sind 100 Millionen weitere Menschen dem Hunger zum Opfer gefallen.
Doch das globale Ernährungssystem benötigt nicht die Gier von Händlern, um zu scheitern: Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) schätzt, dass 757 Millionen Menschen chronisch unterernährt sind. Bei der Frage nach Nahrungsmittelsicherheit – dem Zugang zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung – liegt die Zahl sogar bei 2,8 Milliarden Menschen. Das ist mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung.

Das anfällige globale Ernährungssystem
„Das heutige globale Ernährungssystem, das auf Fernhandel und einer Handvoll riesiger Konzerne basiert, ist extrem anfällig für Störungen“, erklärt Chantal Clément, stellvertretende Direktorin von IPES-Food, einem internationalen Expertengremium. Der Markt scheint in den Händen weniger Akteure zu liegen: Nur vier Handelsunternehmen kontrollieren 75 % des weltweiten Getreidehandels. Und 75 % des weltweiten Saatgutmarkts werden von nur zehn multinationalen Konzernen beherrscht! Darunter sind Bayer-Monsanto, DuPont und Syngenta, die zu den sechs Unternehmen gehören, die drei Viertel des globalen Pestizidmarkts ausmachen.
„Diese langen Lieferketten und die Konzerne, die darüber entscheiden, was und wie angebaut wird, gefährden die Ernährungsvielfalt und lenken Nutzpflanzen in die Produktion von Biokraftstoffen und Tierfutter oder in die Herstellung ultraverarbeiteter Lebensmittel“, so Chantal Clément weiter.
Eine schwer verdauliche ökologische Bilanz
Das aktuelle System ist darauf ausgelegt, Gewinne für wenige zu generieren, jedoch nicht, um die vielen zu ernähren: Intensivlandwirtschaft für den globalen Markt beansprucht zwei Drittel der landwirtschaftlichen Fläche und Ressourcen, versorgt jedoch nur ein Drittel der Weltbevölkerung.
„Es hat sich gezeigt, dass lokale Lebensmittelversorgungsketten besonders in Krisenzeiten viel zuverlässiger sind“, so Chantal Clément weiter. „Bis zu 70 % der Weltbevölkerung werden von kleinbäuerlichen Produzenten und Landwirten ernährt – über öffentliche Märkte, Straßenhändler, Genossenschaften, urbane Landwirtschaft und Direktverkäufe online. Diese Systeme sind es, die die Welt tatsächlich ernähren.“
 Foto von Stéphane Gartner
Foto von Stéphane Gartner
Die wahren Umweltkosten globaler Lebensmittelketten
Schon genug? Dann folgt nun der größte Brocken: die Umweltkosten dieser langen Lebensmittelketten. Der Transport von Nahrungsmitteln hat einen enormen Einfluss (fast 20 % der globalen Emissionen des Lebensmittelsystems, oder 6 % der gesamten menschlichen Emissionen), aber das Hauptproblem liegt in der Produktion.
Der weltweite Lebensmittelhandel hat intensive Monokulturen auf großen Flächen gefördert – Nahrungsmittel für Supermärkte, voll von Pestiziden und Herbiziden, die oft auf Kosten von Anbauflächen für die lokale Ernährung gehen. In den letzten 50 Jahren hat sich der Einsatz von Pestiziden weltweit vervierfacht! „Monokulturen und ihre Abhängigkeit von schädlichen Chemikalien stellen eine große Bedrohung für unsere Fähigkeit dar, die Menschen zu ernähren, für die Tierwelt und für unsere Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel“, erklärt Chantal Clément. „Diese einheitlichen, industriellen Landschaften erschöpfen die Bodengesundheit, erhöhen die Anfälligkeit für Schädlinge und Krankheiten und treiben Abholzung sowie den Verlust der Biodiversität voran.“
Biodiversität in Gefahr
Laut der FAO ist die landwirtschaftliche Biodiversität im 20. Jahrhundert um 75 % gesunken. Drei Viertel unserer Nahrungsmittel stammen nur von 12 Pflanzenarten und 5 Tierrassen! Chantal Clément betrachtet dies als ernsthafte Bedrohung für die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft: „Diese genetische Uniformität bei Pflanzen und Tieren hat die Anfälligkeit für Epidemien und Umweltstress, einschließlich des Klimawandels, deutlich erhöht. Aber neben den Umweltkosten führt die Ausweitung von Monokulturen auch zu Landkonflikten, die oft in Zwangsräumungen und der Marginalisierung ländlicher Gemeinschaften enden. Letztlich fesseln industrielle Monokultursysteme die Landwirte an ein teures, nicht nachhaltiges Modell, das die natürlichen Ressourcen erschöpft und die Vielfalt unserer Nahrungsmittel gefährdet.“
Vielleicht ist es an der Zeit, auf agroökologische Landwirtschaft und kurze Lieferketten zu setzen.
Autor: Aurélien Culat




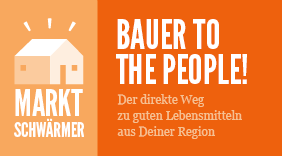




 Foto von Stéphane Gartner
Foto von Stéphane Gartner



Kommentare